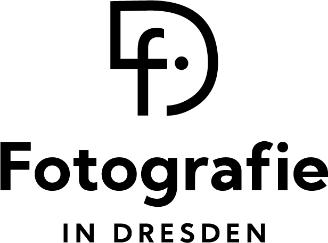Wo ist das Neue?
Foto: »Shower« (Birthe Piontek, Finalist PORTRAITS AWARD 2018)
Fotografische Technik hin oder her – in den Tiefen der Bilderberge von anderen suchen wir nach Mitteilungen über uns selbst.
Mit der totalen Verfügbarkeit (vulgo: Demokratisierung) ist die Bildsprache der Fotografie ebenso wie die gesprochene Sprache für jedermann auf jeder denkbaren Höhe für jeden denkbaren Inhalt einsetzbar geworden. Im Unterschied zu letzterer bedarf es jedoch keiner Übersetzungen; die scheinbar universelle Sprache der Bilder erfüllt so gesehen die nicht verwirklichten Träume des „Doktor Esperanto“ Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917), dem es mit seiner Plansprache darum ging, „ein Mittel zu finden, die Gleichgültigkeit der Welt zu überwinden, und dieselbe zu ermuntern, sofort und ‚en masse‘ von dieser Sprache, als von einer lebenden Sprache, Gebrauch zu machen…“. Nun wäre es aber vermessen anzunehmen, die fotografische Inflation der vergangenen Jahrzehnte hätte die „Gleichgültigkeit der Welt“ überwinden können. Doch hat sie ohne Zweifel dazu beigetragen, dass wir erkannt haben: sie ist in allen ihren Teilen und Lebensweisen gleich gültig.
Wie könnte das besser belegt werden als durch die „Bilder vom Menschen“? Denn darum geht es vor allem beim PORTRAITS – HELLERAU PHOTOGRAPHY AWARD 2018. Das Porträt als fest umrissenes fotografisches Genre ist – betrachtet man die Einsendungen – eher in der Minderheit. Denn ein Porträt entsteht durch eine Vereinbarung zwischen dem Fotografen und dem Fotografierten zum gegenseitigen Vorteil mit dem Blick auf den Betrachter. Roland Barthes hat das so beschrieben: „Das Porträt ist ein geschlossenes Kräftefeld. Vier imaginäre Größen überschneiden sich hier, stoßen aufeinander, verformen sich. Vor dem Objektiv bin ich zugleich der, für den ich mich halte, der, für den ich gehalten werden möchte, der, für den der Fotograf mich hält, und der, dessen er sich bedient, um sein Können vorzuzeigen.“
Das Porträt stellt die Frage nach den Beziehungen, die die Parteien vor und hinter der Kamera mehr oder weniger bewusst untereinander eingehen, und wie sie ihr Verhältnis zum Betrachter bestimmen. Zumeist handelt es sich nicht um wirtschaftliche Verträge, sondern um nichtmaterielle Verabredungen zum gegenseitigen Vorteil. Das eigene Bild als Kunstwerk kann den sozialen Status des Abgebildeten stabilisieren oder seine Repräsentativität steigern – oder es kann ganz im Gegenteil eine Botschaft aus sozial gemeinhin ausgegrenzten Bereichen senden, um diese ins Bewusstsein der Allgemeinheit zurückzuholen. Fotografiert werden kann dann bedeuten, als Existenz wieder ernst genommen zu sein. Zwischen diesen Polen gibt es viele Variationen von Verträgen. Ihnen liegt die Vorstellung zugrunde, dass autonome Personen eine Übereinkunft treffen, die auf den Erfolg aller zielt, die an ihr beteiligt sind. Im Hinblick auf die Fotografie erfordert dies eine gemeinsame Arbeit am Bild, bei der der Fotograf in der Regel den Rahmen setzt, während die dargestellten Personen sich mit persönlichem Engagement an dem Prozess beteiligen und ihn wesentlich prägen. Dabei entstehen unterschiedliche Grade der Konkretheit dieser Vereinbarungen, die den Beteiligten ihre Handlungsräume und -formen zuweisen.
Dieses analytische Besteck zur Bildbetrachtung ist durchaus hilfreich, auch wenn es nur selten eindeutige Ergebnisse zeitigt. Denn die „Bilder vom Menschen“ haben auch dann eine Intention, wenn ihre Autoren sich darüber keinerlei Rechenschaft ablegen. Die Fotografie hat sich von den traditionellen Fragen nach Ähnlichkeit, Authentizität, Aura oder dokumentarischer Qualität längst verabschiedet und dabei in immer stärkerem Maße Strategien der bildenden Kunst in sich aufgenommen. Wie diese hat sie die Aufgabe des Abbildens von Wirklichkeit verlassen, um sich ganz ihrer Erfindung zuzuwenden. Und oftmals schließt sich hier im Menschenbild gleichsam ein Kreis: Nicht der Fotograf erfindet das Menschenbild, sondern der Mensch selbst erfindet sich neu, um sein Bild davon in die Welt hinauszusenden. Und oft verstellt das Bild die Realität, was uns zu dem Fehlschluss verleiten kann, es gäbe diese gar nicht. Und noch etwas: Menschen, die wissen, dass sie fotografiert werden, neigen dazu, die Rolle ihrer Wunschidentität vorzuspielen, was letztlich dazu führt, dass sie sich selbst mit dem Auge der Kamera sehen: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“
Aber damit nicht genug. Ausdrücklich weist die Ausschreibung darauf hin, dass elektronische Nachbearbeitungen der Bilder erlaubt sind. Und davon wird reichlich und mit Genuss Gebrauch gemacht – bis hin zur Montage von fotografischer found footage aus dem Internet. Was wäre vor diesem Hintergrund die Frage nach der Qualität des fotografischen Menschenbildes? Und welcher Qualität eigentlich? Der technischen? Der künstlerischen? Der Qualität der Mitteilung? Oder der des Mitgeteilten? Von dem großen Arno Fischer stammt der schöne Satz: „Wenn ich einen Menschen an einer Bushaltestelle fotografiere, muss auf dem Bild mehr zu sehen sein als ein Mensch an einer Bushaltestelle“. Das hat er wie alle bedeutenden Autoren-Fotografen meist geschafft, auch und vor allem mit seinen Porträts von Arbeitern und Künstlerinnen. Doch waren die sämtlich analog, selbst hergestellt im eigenen Labor, Zeugnisse einer hochspezialisierten „Kulturtechnik“, wie es sie auch heute noch gibt.
Bei allem Wildwuchs in den Linsen und Computern ist unser Denken über Bilder von diesen Erfahrungen des Sehens bis heute geprägt. Denn wir suchen – Technik hin oder her – in den Tiefen der Bilderberge von anderen nach Mitteilungen über uns selbst. Wo sonst wäre das Neue?
Matthias Flügge
Der Text ist ein Beitrag zum Katalog des PORTRAITS – HELLERAU PHOTOGRAPHY AWARD, der im Februar 2018 im Verlag der Kunstagentur Dresden erscheint.